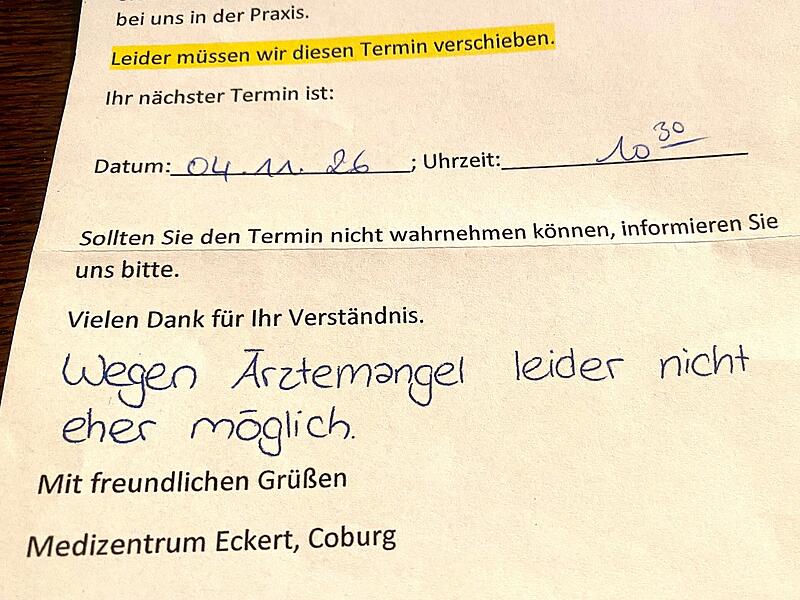Na, erwischt! Du bist wohl ein bisschen zu neugierig, was?
Besuch auf Intensiv
Corona macht den Tod zum Alltag

Coburg
– Erstickende Patienten, leugnende Angehörige: Mediziner der Regiomed-Klinik geben exklusive Einblicke, wie dramatisch die Pandemie wirklich ist.
Artikel anhören